SEMINAR-INSTITUT - Individuelle Fach- & Führungskräfte Seminare
Ihr professioneller Anbieter von Seminaren und Weiterbildungen aus dem gesamten Bereich des Managements.
Unsere Referenzen
 SAP
SAP
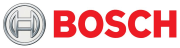 BOSCH Power Tec
BOSCH Power Tec
 bonprix
bonprix
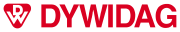 DYWIDAG
DYWIDAG
 REEMTSMA
REEMTSMA
 unicef
unicef
 KfW Bankengruppe
KfW Bankengruppe
 Continental
Continental
 Mitteldeutsche Rundfunk
Mitteldeutsche Rundfunk
 AIRBUS
AIRBUS
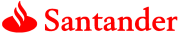 Santander
Santander
 Bayerisches Landeskriminalamt
Bayerisches Landeskriminalamt
 Westfalen
Westfalen
 WAGNER
WAGNER
 SANOFI
SANOFI
 WWK Versicherungsgruppe
WWK Versicherungsgruppe
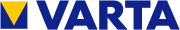 VARTA
VARTA
 TÜV Süd
TÜV Süd
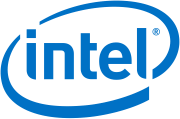 intel
intel
 Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen
Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen
 MEILLER
MEILLER
 acxiom
acxiom
 H&M
H&M
 Bilfinger HSG
Bilfinger HSG
 MEIKO
MEIKO
 TÜV Nord
TÜV Nord
 Allianz SE
Allianz SE
 Deutsche Messe
Deutsche Messe
 LOTTO Land Brandenburg
LOTTO Land Brandenburg
 Haufe Lexware
Haufe Lexware
 Thyssenkrupp
Thyssenkrupp
 Walser Privatbank
Walser Privatbank
 MAN
MAN
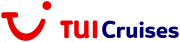 TUI Cruises
TUI Cruises
 Koelnmesse
Koelnmesse
 BioNTech
BioNTech
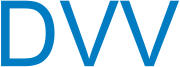 Duisburger Versorgungs und Verkehrsgesellschaft
Duisburger Versorgungs und Verkehrsgesellschaft
 ebmpapst
ebmpapst
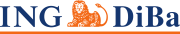 ING-DIBA
ING-DIBA
 Roche Diagnostics
Roche Diagnostics
 Stiftung Warentest
Stiftung Warentest
 SOS Kinderdorf
SOS Kinderdorf
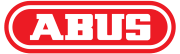 ABUS
ABUS
 Deutsche Rentenversicherung
Deutsche Rentenversicherung
 DencoHappel
DencoHappel
 Bayer HealthCare
Bayer HealthCare
 PUMA SE
PUMA SE
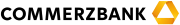 COMMERZBANK
COMMERZBANK
 Carglass
Carglass
 DEKRA
DEKRA
 IHK Stuttgart
IHK Stuttgart
 VORWERK
VORWERK
 VOLKSWOHL BUND
VOLKSWOHL BUND
 Deutsche Bahn
Deutsche Bahn
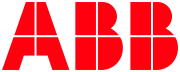 ABB
ABB
 Outotec
Outotec
 BAVARIA Yachtbau
BAVARIA Yachtbau
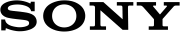 SONY
SONY
 Sparda Bank Hessen
Sparda Bank Hessen
 Ludwig Stocker Hofpfisterei
Ludwig Stocker Hofpfisterei
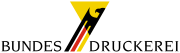 Bundesdruckerei
Bundesdruckerei
 AOK Plus
AOK Plus
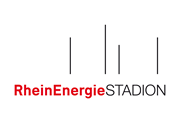 RheinEnergieStadion
RheinEnergieStadion
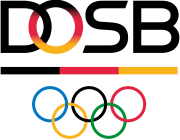 Deutscher Olympischer Sportbund
Deutscher Olympischer Sportbund
 BMW Bank
BMW Bank
 SportScheck
SportScheck
 Arbeiter-Samariter-Bund
Arbeiter-Samariter-Bund
 NOMOS Glashütte
NOMOS Glashütte
 AOK Bayern
AOK Bayern
 Berliner Sparkasse
Berliner Sparkasse

